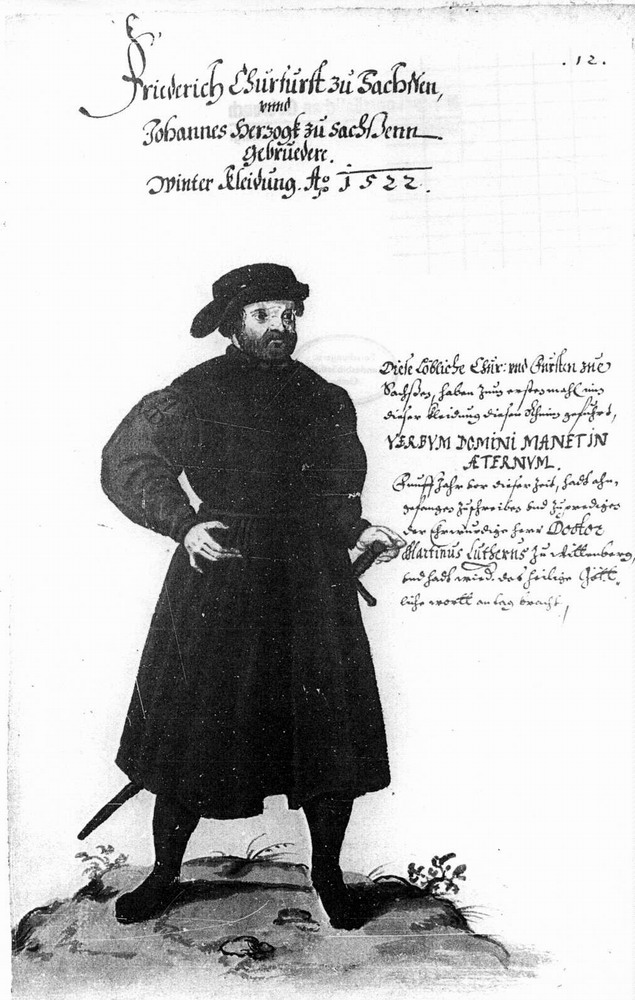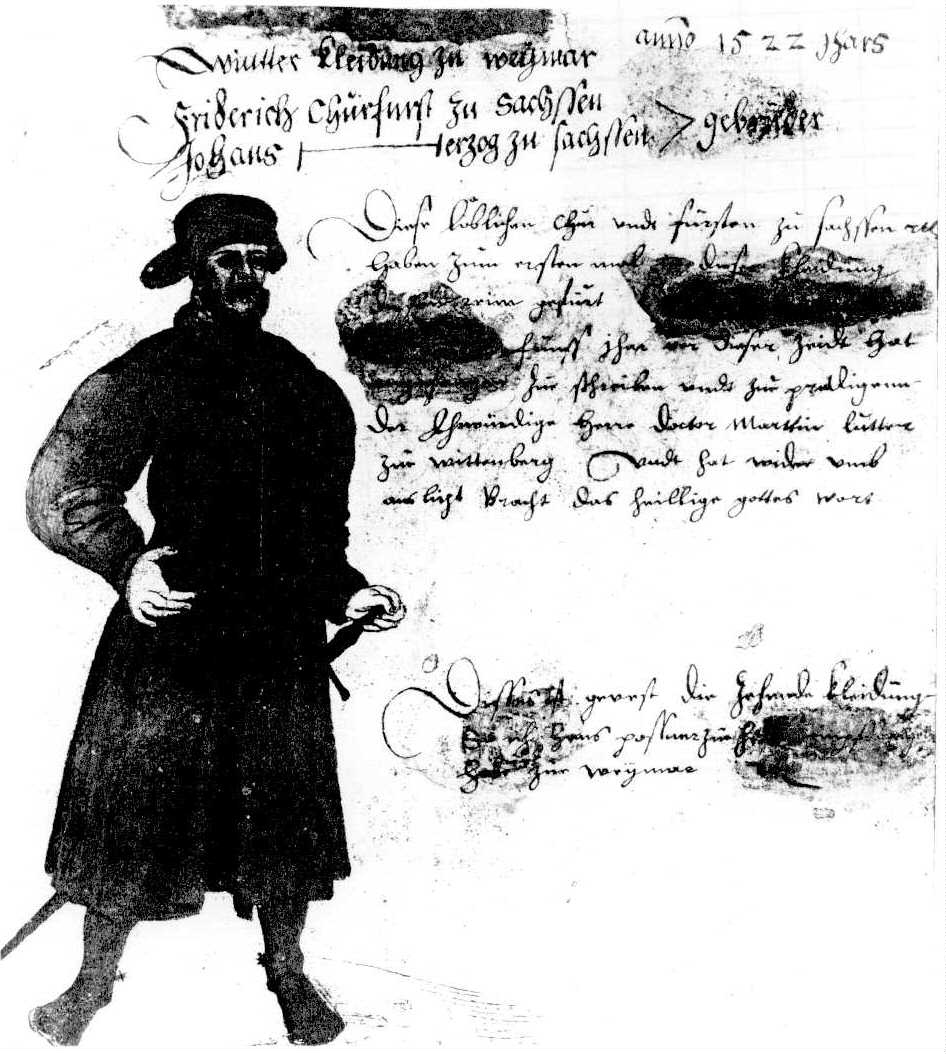Das Auftauchen der Devise 1522
Seit 1522 verbreitet sich das
Motto: VERBVM DOMINI MANET IN ÆTERNVM explosionsartig.
Manlius berichtet, wie sich
Friedrich
der Weise für diese Devise entschied.
Exkurs: Weitere
schriftliche
Quellen
Münzen
Exkurs: Ikonographie
der Münzen
und Textilien
Friedrich der Weise und
DIE WAHL DES MOTTOS ALS DIPLOMATISCHE MEISTERLEISTUNG (Warum
gerade
dieses Motto?)
Der Bericht des Manlius
1562
Die älteren Autoren beziehen sich bei der Behandlung des Mottos
fast alle auf folgenden Bericht des Manlius
Locorum communium
collectanea
1562: Seite 290
Duces Saxoniæ illud ursurparunt: Verbum Domini manet in
æternum.
Initio autem electum fuit a duce Friderico, hoc pacto: Cum
iußisset
dominus Spalatinum colligere aliquot bona dicta ex multis, queæ
ille
conscripserat, hoc unicum elegit.
Idem symbolum Verbum Domini manet in æternum, usurpauit
Georgius
Marchio Brandenburgensis: quot quadiu uixit, seruauit.
Die Fürsten von Sachsen verwendeten folgendes (Motto): Verbum
Domini manet in aeternum. Folgendermaßen entschied sich Herzog
Friedrichs
(der Weise) für dieses Motto: Der Herrscher befahl Spalatin eine
Sammlung
von vielen guten Sprüchen anzulegen und wählte dann aus den
vielen,
die dieser aufgeschrieben hatte diesen einen aus.
Dasselbe Motto übernahm auch Markgraf Georg (der Fromme) von
Brandenburg und bewahrte es sein Leben lang.
["initio..." diese Version des Manlius wird zwar oft zitiert,
aber Manlius gibt keine Quelle für diesen Bericht an. Auch sonst
kenne
ich keine Quelle, die diesen Bericht stützen würde. Dennnoch
paßt die Erzählung so gut zu den beteiligten Personen,
daß
sie, falls nicht wahr, zumindest gut erfunden ist.
"Markgraf Georg"
Auch hier fehlen Belege.
Exkurs: Weitere
schriftliche
Quellen, die darüber Auskunft geben, warum (wann?, von wem?)
dieses
Motto ausgewählt wurde.
- Spalatin annales
Saxoniae:
zu
1522
Hac æstate curavit Princeps noster Fridericus Dux Saxon.
Elector
nomismata argentea hic Nurmbergæ excudenda, effigiem suam
pulcherrime
referentia, partim quæ singula aureum penderent, partim quorum
septem
aureum valorum reddant. Utraque cum hac inscriptione in altero
latere:
Verbum Domini manet in æternum. Quæ mirum quanta in
admiratione
fuerint apud plerosque fere omnes, potisimum vero pios &
verbi
studiosos.
in diesem Sommer veranlaßte unser Fürst, Friedrich der
Churfürst von Sachsen daß hier in Nürnberg
Silbermünzen
geprägt wurden, deren eine Seite sein Gesicht aufs Schönste
zeigte.
Zum Teil entsprachen diese Münzen dem Wert eines Goldguldens,
zum
Teil entsprachen sieben von ihnen dem Wert eines Goldguldens.
Beide mit
folgender Inschrift auf dem Revers: Verbum Domini manet in
aeternum.
Sie
wurden von den meisten, fast von allen außerordentlich
bewundert;
vor allem von den wirklich frommen und denen, die sich mit dem
Wort
Gottes
beschäftigen.
[hac aestate..hic Nurmbergae .. wann hat Spalatin
den
Text verfaßt? Er war 1524 und 1532 in Nürnberg]
[singula aureum penderent... Die ursprüngliche
Bedeutung
des Guldengroschens: Eine Silbermünze ("Groschen") im Wert eines
Guldens
(aureum)]
[quorum septem...die sogenannten "Schreckenberger"
hatten
den Wert 1/7 fl]
[altero latere ??]
- Princeps noster Dux Fridericus Saxon. Elector suis hybernam
vestem dedit
cum his literis dextera manica in longitudinem intertextis:
V.D.M.I.E.
Id est: Verbum Domini Manet In Eternum
Unser Fürst Herzog Friedrich, Kurfürst von Sachsen gab
seinem Hofstaat[Wörtl: den seinen] ein Winterkleid, in dessen
rechten
Ärmel folgende Buchstaben der Länge nach hineingewebt [oder
hineingestickt?]
waren: VDMIE d.h. Gottes Wort bleibt ewig.
[hybernam: Winterkleidung ]
[in longitudinem intertextis - kann man aus diesem Text auf die
Art
der Befestigung schließen?]
sonstige Texte:
- Leichenpredigten
und
Nachrufe
auf Friedrich erwähnen das Motto nicht.
- In Luthers
Schriften
kommt
das Motto zwar nach 1522 (quasi als Zitat) häufig vor, aber
vor
1522
nicht. d.h. Luther hat dieses Motto werder ausgewählt, noch
die
entsprechenden
Bibelstellen vor der Veröffentlichung des Mottos durch
Friedrich
besonders
betont.
- sekundär hat sich das Motto schnell
verbreitet
(z.B. Haug
Marschalk)
- Weitere Quellen im Zusammenhang mit Münzen
und
Textilien
bringen keine neuen Erkenntnisse. (z.B. Bitte um bzw. Dank für
Zusendung
der neuen Münzen, Rechnungen für das Besticken der Textilien
mit dem Motto usw.)
- Nürnberger Reichstagsakten
und der Briefwechsel mit Hans
von der
Planitz erwähnen
weder das Motto noch die entsprechenden Münzen und Textilien.
Es
existieren
noch viele weitere Quellen zu den Ereignissen des Jahres 1522
in
Nürnberg.
Möglicherweise findet man dort Hinweise darauf, welche
Reaktionen
das Motto auf den Münzen und Uniformen hervorrief und ob es
damals
weitere Medien gab, die der Verbreitung dieses Mottos dienten.
Münzen
Das Motto VERBVM DOMINI MANET IN AETERNVM
erscheint 1522 auf der unten abgebildeten Münze.
A1a Guldengroschen
................................................
 
A1e Schreckenberger

A1b Guldengroschen
ohne Arabesken
in der Jahreszahl
 
|
Am 22.5.1522 schickt
Friedrich
100
Mark Silber an Anton Tucher
in Nürnberg mit
dem Auftrag daraus
Münzen
zu prägen: und dabey in einem buchslein ein
visierung
eins
gepreg uf eyn muntz, und die platten derselben soll so
breyt werden,
alss
der zeirck und umbschrifft uff dem steyn begreift, und das
angesicht
soll
uf die eyn seiten der muntz, und auf der andern seyten das
kreutz mit
der
schrift, wie es uf das pappier
gerissen,
seyn, und begern darauff genediglich, ir wellet bestellen,
dass uns
demnach
stempfel gemacht werden, ufs reynlichst es sein mag, und
darnach aus
den
hundert marck silbers
groschen,
der eyner ein gulden halt....und wen die muntz recht
gefellig
werde,
so seind wir bedacht, dar uber die hundert marck mer
machen zu lassen.
L: Ehrenberg
S101-103
Am 29.6. hat Friedrich einen
Abdruck der Vorderseite
erhalten: "mit dem angesicht, das uns wol
gefellt.... Wir sein
auch bedacht, eine muntz schlaen zu lassen, der
sieben groschen ein gulden gelden..."
Am 30.6. schreibt
Friedrich
zur Rückseite: Er wünsche, "dass die
zeuge
auch nit in die jahrzall gemacht, sondern dass die
platten neben der
Schrift
glatt weren..."
Weiter ergibt sich aus diesem Briefwechsel:
Tucher sollte diese Prägungen geheim halten.
Sie sollten von Gewicht und Feingehalt den gängigen
sächsischen
Münzen entsprechen.
Schon nach kurzer Zeit werden diese Münzen auch in
Annaberg
(Sachsen)
geprägt, da der Nürnberger Münzmeister Hans Kraft andere
Gehaltsvorstellungen hat, als der Kurfürst. Am 11.Februar
1523
hatte
Kraft das übersandte Silber vermünzt. Hiermit endeten die
Nürnberger
Prägungen für Friedrich.
Hans Kraft prägte vom 29.6.1522 bis 11.2.1523 insgesamt
625 Guldengroschen
und 15208 Schreckenberger.
Dazu einige vergoldete und goldene Stücke.
|
Wann wurde das Motto erstmals auf Münzen
verwendet?
Abgesehen von dem Wittenberger Einbandstempel
von
1520 scheint der Brief vom 22.5.1522 (Friedrich an
Tucher)
das
früheste Zeugnis für das Motto auf Münzen zu sein,
obwohl
der Spruch in ihm gar nicht erwähnt wird. In dem Brief wird ein
Entwurf
(Visierung) für die Münze erwähnt. Da von der Idee bis
zum
fertigen Entwurf sicher auch einige Zeit vergangen ist, muß die
entsprechende
Anweisung spätestens Ende April 1522 erfolgt sein.
Exkurs: Ikonographie
der
ersten Prägungen mit dem Motto
Friedrich konnte bei der Motivauswahl für seine Prägungen
nicht auf eine lange ikonographische Tradition zurückgreifen. Die
Umstellung von der Groschenwährung auf Großsilbermünzen
(Dies ist in der Numismatik der Übergang vom Mittelalter zur
Neuzeit.)
war erst in den letzten 30 Jahren erfolgt. Im Zuge dieser
Umstellung
wandelte
sich auch die Form und z. T. auch der Inhalt der Darstellungen.
Mittelalterliche
Münzen waren klein (Durchmesser 1-3cm) und dünn (< 1 mm) .
Die Inschrift bestand aus gotischen Minuskeln und war meist
unleserlich.
Mit der Umstellung auf große (3-4cm Durchmesser, 1-3mm dick)
Münzen hatte man einerseits eine größere Fläche
für
die Darstellung zur Verfügung, andererseits erforderten die
dickeren
Schrötlinge (= Metallscheibe aus der die Münze hergestellt
wird)
eine andere Prägetechnik, die ein höheres Relief und damit
schärfere
Konturen ermöglichte.
| Portrait |
üblich |
|
Titel in
Umschrift |
üblich |
|
| Wappen |
normalerweise groß auf der Rückseite
schrumpft zu Trennzeichen in der
Vorderseitenumschrift |
in Sachsen seit ca 1500
Keilitz
Nr
4;16-20,42-50 |
| Bibelspruch |
bisher sehr selten, von jetzt ab häufig |
|
Doppelter
Schriftkreis |
kommt gelegentlich vor |
1507: Keilitz
Nr 69 |
VERBUM
DOMINI.. |
erstmals auf dieser Münze,
später häufig |
|
| Jahreszahl |
üblich |
|
| Kreuz |
An dieser Stelle steht sonst das Wappen.
Ein Kreuz an dieser Stelle ist auf großen
Silbermünzen unüblich.
Auf mittelalterlichen Münzen war es häufig. |
1507 Wappen mit Kreuz kombiniert
Keilitz
Nr
69/72/82 |
| CCNS |
kommt nur bei Friedrich vor (seit 1517) |
Keilitz
Nr 74 |
Ausführlicher zur Ikonographie dieser
Prägung:Christensen
S28-29
Neben den Münzen gab es noch ein zweites
Medium,
das zur Verbreitung des Mottos diente:
Die kursächsischen Hofuniformen
An den Ärmeln der Kurfürstlichen Hofuniformen wurden die
Buchstaben VDMIÆ aufgenäht.Diese Uniformen wurden jeweils
zweimal
jährlich (Sommer- bzw. Winterkleidung) an die Angehörigen des
(Kur-)fürstlichen Hofes verteilt. Dadurch war das Motto
schlagartig
in ganz Kursachsen präsent. Aber nicht nur in Kursachsen, sondern
auch in Nürnberg, dem Sitz von Reichsregiment, Reichskammergericht
und Reichstag (In jedem dieser Gremien war Kursachsen durch
kompetente
Diplomaten vertreten.)
Zuständig für die Beschaffung und Verteilung dieser Uniformen
war ein HANS POSER. Sowohl von seinen Konzept- und Musterbüchern,
als auch von seinen Abrechnungen existieren viele noch heute. L:
Dihle
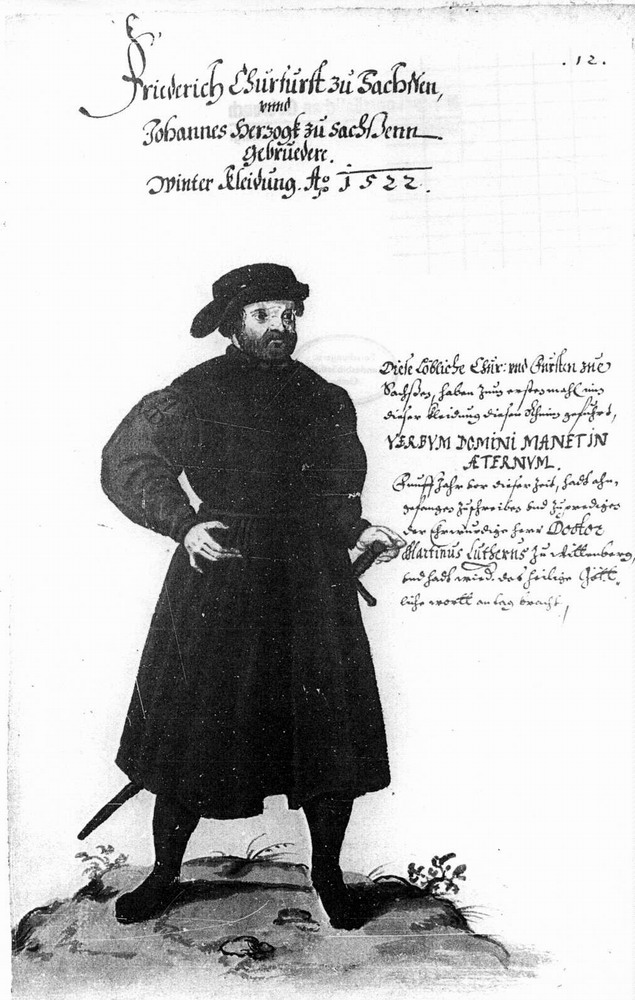
Für unsere Untersuchung sind besonders die 93 Kostümbilder
(darunter viele Doubletten) wichtig, die sich in verschiedenen
ernestinischen
Archiven und Bibliotheken erhalten haben. DihleS128
Diese Bilder dienten als Vorlagen für die Schneider, die die
Textilien
herstellen mußten. (daher auch die vielen Doubletten). Jedes der
Bilder enthält eine Über- (bzw. Unter-) schrift, die
darüber
informiert, wann (und häufig auch: wo) diese Kleidung verteilt
wurde.
Viele Bilder enthalten auch einen kurzen Kommentar, der wichtige
Ereignisse
aus der Zeit nennt, zu der diese
Kleidung getragen wurde.
Die Abbildung links zeigt ein Blatt (Forschungsbibliothek
Gotha,
Chart. A 233 Bl. 8r) auf dem Hans Poser folgendes
vermerkt
hat:
[Überschrift:] Friedrich Churfürst zu Sachssen und
Johannes
Herzogk zu Sachssen gebrueder Winter Kleidung Ao 1522 [Kommentar:]Diese
löbliche:
Chur= und Fürsten zue Sachßen, haben Zum
erstenmahl
in dieser Kleidung diesen Rheim gefuhrd VERBVM DOMiNi MANET IN
ÆTERNVM.
Funff Jahr vor dieser Zeit, hadt ahngefangen Zu schreiben und zu
predigen
der ehrwurdige Here Doctor Martinus Lutherus zu Wittenberg auch
hat
wied.
das heilige Gött liche wort an tag bracht
Das älteste der Kostümbilder (Kunstkabinett
Weimar KK 153) zeigt die Sommerkleidung 1514, das
jüngste (Forschungsbibliothek
Gotha, Chart. A 233 Bl. 30) die Winterkleidung 1589 Auf
einigen
der Bilder (1522-1554) kann man die Ärmelinschrift VDMIÆ
erkennen.
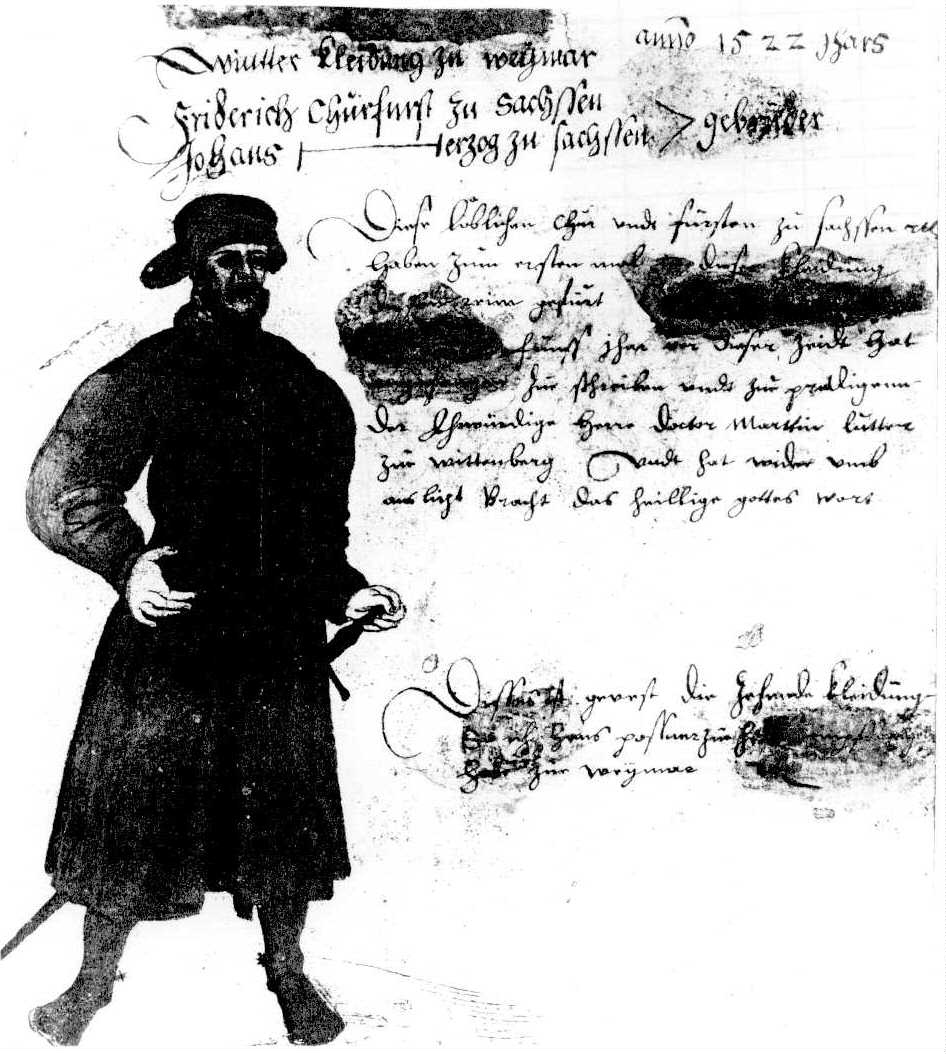
Dies
(Kunstkabinett Weimar KK 157) ist eine
Doublette
von obiger Abbildung.Sowohl auf dem Bild, als auch im Text sind
die
Buchstaben
VDMIÆ geschwärzt.Es ist unbekannt, wer? warum? das Motto
zensiert hat.
Immerhin bleibt die ehrende Erwähnung Luthers unzensiert.
Ich konnte dieses Blatt nie persönlich einsehen.
Daher halte ich auch folgende Erklärung für nicht
ausgeschlossen:
Das Motto sollte nicht zensiert, sondern farbig hervorgehoben
werden
(Vorläufer
eines Textmarkers). Später ist die Farbe nachgedunkelt
Das nächste Bild stammt aus demselben Band wie das erste .(Chart.A233
Blatt 9r die Schrift habe ich in anderer Farbe nachgezeichnet,
um sie
besser
lesbar zu machen.)

Obwohl es nach der Winterkleidung 1522 eingebunden ist,
zeigt
es die Sommerkleidung von 1522.Wir haben also folgenden paradoxen
Befund:
Obwohl die Sommerkleidung ein halbes Jahr älter ist, als die
Winterkleidung,
behauptet Hans Poser, dieses Motto sei erstmals auf der
Winterkleidung
verwendet worden.
Wurde das Motto erstmals auf der Sommerkleidung verwendet, so wäre
das Motto auf Uniformen früher als auf Münzen
verwendet
worden.
Rätsel:
?
-
Wann (an welchem Tag) wurde die Sommerkleidung verteilt?
-
Wielange muß die Vorlaufzeit sein, d.h. zu welchem
Zeitpunkt
muß
die Anweisung zur Verwendung des Mottos spätestens
gegeben worden
sein?
-
Hat sich Poser geirrt, wenn er die erste Verwendung des
Mottos bei der
Winterkleidung 1522 anmerkt
-
oder ist die Überschrift: "Sommerkleidung 1522"
über
dem
Bild mit den Buchstaben falsch?
-
War es damals üblich, auf Uniformen Mottos zu verwenden?
Antworten und
Hinweise an
kohleraichig@gmx.de
|
Die Beantwortung würde den
Rahmen dieser Arbeit sprengen, doch
weise
ich auf einige Fakten hin, die bei der Antwort
berücksichtigt
werden sollten:
- Die Blätter in dem Gothaer
Manuskript Chart
A233 wurden schon vor langer
Zeit (wann?)
zusammengebunden.
Es existieren zwei verschiedene Paginierungen, die
beide mit der
heutigen
Reihenfolge übereinstimmen. Diese Reihenfolge ist im
allgemeinen
chronologisch.
Ausnahme: In den Jahren 1521 und 1522 kommt die
Winterkleidung vor der
Sommerkleidung.
- Die Kommentare wurden erst nach
einigen Jahren
angebracht
(möglicherweise erst nachdem die Gothaer Blätter
zusammengebunden
worden sind.). Z.B. enthält der Kommentar zur
Winterkleidung 1521
einen Hinweis auf den Tod von Johanns Tochter
Margaretha (+1535)
- Trotzdem finden sich oft dieselben
Kommentare auch
auf den
Doubletten.
- Auch Spalatin
beschreibt das
Motto
im Zusammenhang mit der Winterkleidung 1522.
- 1498 kaufte Friedrich der Weise für
2 Gulden
Perlen
für Buchstaben auf einem Samtärmel. DihleS134
Auch der Wetterauer
Grafenverein
verwendete Devisen auf Uniformen: BEDENCKS END (1533) W.ie
G.ott W.ill
(1547) G.ott F.ügts Z.um Besten (1548).
Der Text in L: Hessen
Nr. 557
(bezugnehmend
auf die Schneiderrechnungen im Ysenburger Archiv zu
Büdingen)
scheint
anzudeuten, daß dort diese Sitte schon 1516 bestand
|